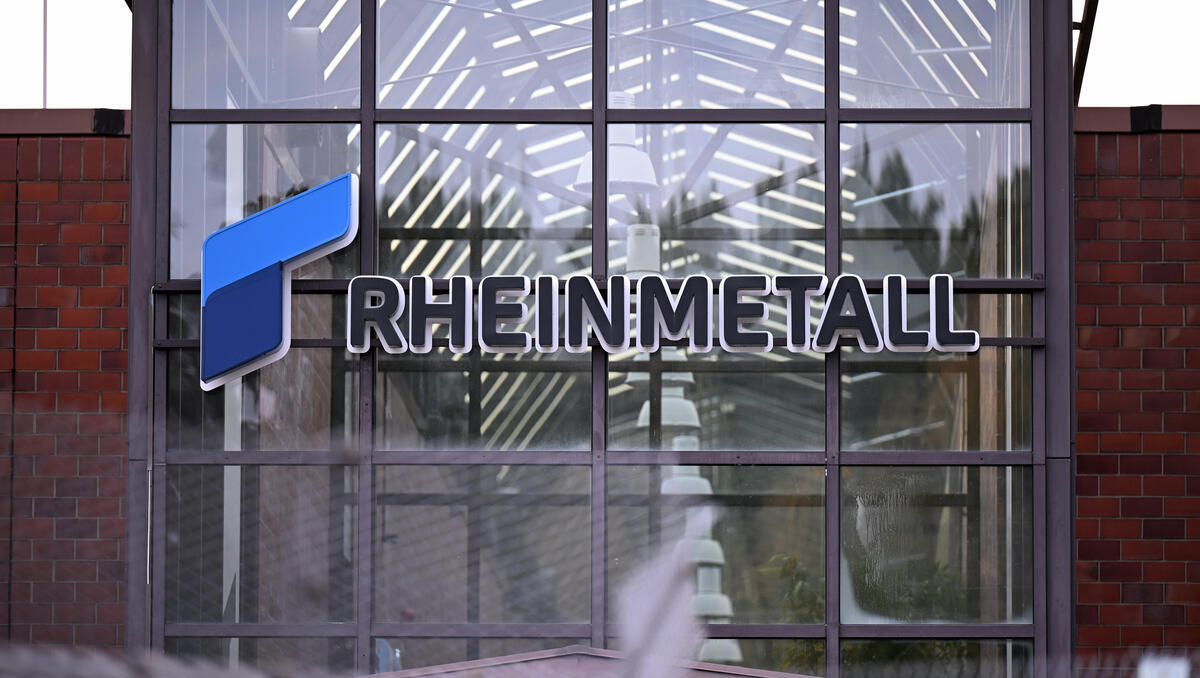Wer die KI beherrscht, beherrscht die Welt
Künstliche Intelligenz ist die entscheidende Technologie des 21. Jahrhunderts. Und die dazugehörige Wertschöpfung wird wohl nicht in Europa stattfinden, sondern den USA und China. Und damit auch Arbeitsplätze, Steuern und Wohlstand.
Die KI-Revolution, die gerade erst begonnen hat, dürfte ähnlich wie Smartphone, Internet und Social Media die Art und Weise transformieren, wie wir leben, lieben, arbeiten - bloß in noch größerem Maßstab. Millionen Arbeitsplätze werden wegfallen, weitere Millionen sich radikal an die neue Technologie anpassen. Das betrifft die gesamte Gesellschaft, von Unterhaltung und Freizeit über Industrie, Finanzen und Handel zu Bildung, Recht und Verwaltung.
Aktuell befinden sich die USA und China in einem Kopf-an-Kopf-Rennen darum, wer die schnellste, smarteste und effizienteste Künstliche Intelligenz entwickelt. Denn wer die hat, hat alles und könnte damit beispielsweise die Finanzwelt tanzen lassen, Kriege gewinnen, das Internet und die Inhalte auf Social Media und damit auch die globale Kultur dominieren. Anders gesagt: Der Player mit der besten KI gewinnt den gesamten Topf am Pokertisch. Und dürfte dann exponentiell noch weiter gewinnen und den eigenen Vorsprung ausbauen, weil die KI ihre eigene Entwicklung und die Erforschung anderer Technologien und Strategien weiter beschleunigt. Im Grunde, um ein etwas dramatisch angehauchtes Bild zu bemühen, schaffen die großen Zivilisationen der Welt, die Hegemone, gerade ihre eigenen jeweiligen Gottheiten - die dann vermutlich irgendwann mal mittels Computerviren, Drohnenschwärmen und taktischen Atomschlägen auf Rechenzentren um die weltweite Vorherrschaft kämpfen.
Und Europa? Welche Rolle spielt der alte Kontinent der westlichen Welt dabei in zehn, zwanzig, fünfzig Jahren? Wenn es so weiter geht wie jetzt, wahrscheinlich keine allzu große. Es sieht in vielerlei Hinsicht finster aus: Wir beziehen etwa Solarpanele, Elektroautos und TikTok-Trends von den Chinesen, und unter anderem Google-Suchergebnisse, You-Tube-Videos und KI-Anwendungen von den USA. Lange Zeit bezog die Welt dafür zum Beispiel Verbrenner-Autos aus Deutschland, das war der Deal, der ist nun vorbei. Europa, der reiche Kaufmann der Welt, verliert gerade seinen Wohlstand und lässt die Hosen runter. Zum Vorschein kommt ein Greis, der gerne von alten Zeiten faselt und keine Ahnung hat, worum es gerade wirklich geht. Wir sind in so vielen Punkten von den USA abhängig, dass es schon peinlich ist. Und gefährlich. Das gilt natürlich für das Militär, aber eben auch für digitale Anwendungen und insbesondere KI.
Der Rückstand gegenüber USA und China
Die Dimension der Kluft lässt sich klar beziffern: Laut dem aktuellen Stanford AI Index 2025 wurden im Jahr 2024 in Europa nur drei international relevante KI-Modelle entwickelt – in den USA dagegen 40, in China 15. Während in Kalifornien Milliarden Dollar in die nächste Generation von Sprachmodellen fließen und chinesische Tech-Giganten auf staatliche Unterstützung setzen, tüfteln europäische Start-ups im Vergleich dazu mit deutlich geringeren Mitteln.
Auch bei der Infrastruktur hinkt Europa hinterher. Die USA verfügen über sogenannte Hyperscale-Rechenzentren – gigantische Serverfarmen wie die von Microsoft, Amazon Web Services oder Google, die Millionen von Nutzern und enorme Datenmengen gleichzeitig verarbeiten können. Europa hat bislang kaum eigene Kapazitäten in dieser Größenordnung, sondern ist auf diese Anbieter angewiesen. Die sollen hierzulande auch gebaut werden, in Form sogenannter "Gigafabriken". Aber wie und wo und von wem genau die gebaut werden, ist noch unklar. Klar hingegen ist, dass die europäische Bürokratie weniger flexibel als das amerikanische Venture Capital ist - in das im Prinzip die gesamte Welt investiert. Und auch weniger brutal wie das zentralistische China, deren Partei über weitaus mehr direkte Gestaltungsmacht verfügt als die EU. Immerhin sollen laut EU-Kommission rund 200 Milliarden Euro in KI investiert werden. Ob der AI Act, der die Entwicklung künstlicher Intelligenz regulieren soll, dabei ein bremsendes Hindernis oder gar ein globales Asset ist, wird sich zeigen. Vielleicht beides. Oder vielleicht ist er auch einfach egal, weil wir schon zu weit zurückliegen.
Warum Europa zurückliegt
Die Ursachen sind vielschichtig – und hausgemacht. Zum einen ist die politische Struktur der EU selbst ein Hemmschuh. Entscheidungen dauern lange, nationale Interessen bremsen gemeinsame Strategien aus. Zum anderen ist Wagniskapital knapp. Investoren in Europa scheuen noch immer milliardenschwere Risiken, die in den USA als notwendiger Einsatz gelten. Hinzu kommt, dass Investitionsentscheidungen zersplittert sind: Jeder EU-Mitgliedstaat verfolgt eigene Förderprogramme, oft ohne Abstimmung. Das schwächt die Skalierung.
Ein weiterer Faktor ist die Chip-Produktion. Während die USA und Asien den Markt für KI-Beschleuniger kontrollieren, ist Europa von Importen abhängig. Projekte wie das Intel-Werk in Magdeburg oder die geplante Fertigung von TSMC in Dresden kommen – wenn überhaupt – erst in einigen Jahren. Bis dahin fehlen europäische Chips, um die Rechenzentren mit eigenem Silizium zu versorgen.
Und auch bei den Rechenzentren zeigt sich eine doppelte Schwäche: Zum einen fehlen noch die Hyperscale-Kapazitäten für das Training großer Modelle. Zum anderen sind die Energiekosten in Europa hoch und die Strommärkte fragmentiert. Während US-Rechenzentren mit günstiger, planbarer Energie kalkulieren können, kämpfen Betreiber in Europa mit komplizierten Genehmigungsverfahren, Netzengpässen und ungleichen Strompreiszonen. Der Verband europäischer Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E weist in seinen System-Outlooks regelmäßig auf Engpässe hin.
Was Europa bereits kann
Trotzdem ist das Bild nicht nur düster. Europa verfügt über eine starke Forschungslandschaft, ausgezeichnete Universitäten und traditionsreiche Industrien, die KI-Anwendungen gezielt einsetzen können. Einige Unternehmen zeigen, dass auch hier Weltklasse entsteht:
- DeepL aus Köln gilt als führender Anbieter von KI-gestützten Übersetzungen und konkurriert erfolgreich mit Google Translate.
- Aleph Alpha aus Heidelberg entwickelt Sprachmodelle mit Fokus auf Erklärbarkeit und europäische Sprachen.
- Helsing setzt KI für Verteidigungsanwendungen ein und wird von Investoren wie Spotify-Gründer Daniel Ek unterstützt.
- Mistral AI (Frankreich) – 2023 gegründet, entwickelt das Start-up offene Large Language Models als europäische Alternative zu OpenAI. Schon in der Frühphase flossen Hunderte Millionen Euro an Risikokapital in das Unternehmen, das sich als europäischer Player im Modellbau positioniert.
- Stability AI (Großbritannien) – das Unternehmen hinter Stable Diffusion, einem weltweit führenden offenen Bildgenerierungsmodell. Es wird sowohl in kreativen Industrien als auch in der Forschung eingesetzt.
- Bitdefender (Rumänien) – bekannt für Cybersecurity-Lösungen, nutzt KI zur Erkennung von Bedrohungen in Echtzeit und zum Schutz kritischer Infrastrukturen.
- Corti (Dänemark) – entwickelt KI-Systeme für den Gesundheitssektor, die Notrufdisponenten in Echtzeit bei der Erkennung von Herzstillständen und anderen Notfällen unterstützen.
- Im industriellen Umfeld arbeiten zahlreiche Mittelständler und Großkonzerne wie Audi und Siemens an KI-Lösungen für Fertigung, Logistik und Energie.
Diese Beispiele belegen: Europa kann in Nischen und bei spezifischen Anwendungen erfolgreich sein. Die Chance liegt vor allem dort, wo Industrie-Know-how, Daten und KI zusammenkommen. Wenn es Europa gelingt, KI-Lösungen für die Industrie so zu gestalten, dass die Wertschöpfung auch hierzulande stattfindet, wäre schon einiges gewonnen. Freilich wäre es schön, dann auch eine Lösung zu finden für die damit einhergehenden, sich jetzt schon am Horizont düster abzeichnenden Jobverluste durch KI in nahezu allen Branchen, aber besonders der Industrie.
Was jetzt geschehen müsste
Will Europa das KI-Rennen nicht endgültig verlieren, muss es drei Hebel zugleich bedienen:
- Politische Entscheidungen beschleunigen. Statt jahrelanger Debatten braucht es schnelle, verbindliche Weichenstellungen. Ein EU-weiter KI-Souveränitätsfonds könnte Milliarden mobilisieren, um Unternehmen Zugang zu Rechenleistung und Kapital zu geben.
- Investitionen in Computer und Chips. Die geplanten AI-Factories – also Rechenzentren mit zigtausenden spezialisierten Chips – müssen schnell umgesetzt werden. Europa braucht eigene Kapazitäten für das Training großer Modelle – nicht nur Supercomputer für die Forschung, sondern auch nutzbare Infrastruktur für Start-ups und Mittelstand.
- Energie-Infrastruktur modernisieren. Rechenzentren sollten dort entstehen, wo Strom günstig und Netze stark sind. Flexible Stromverträge, standardisierte Power Purchase Agreements (PPAs) und eine Verpflichtung zur Abwärmenutzung könnten helfen, neue Kapazitäten nachhaltig aufzubauen. Irland geht hier bereits voran: Neue Rechenzentren dürfen sich nur noch ans Netz anschließen, wenn sie eigene Flexibilität und Abwärmenutzung nachweisen.
Parallel dazu muss Europa definieren, wo seine Chancen liegen: in der industriellen KI, im Gesundheitssektor, bei Verwaltungslösungen und im Bereich nachhaltige Energie. Hier ist der Abstand zu den USA kleiner, und die Nachfrage in Europa selbst enorm. Drei Szenarien, wie es weiter gehen könnte:
Szenario 1: Europa verpasst den Anschluss
Bleibt alles beim Alten, setzt sich ein pessimistisches Szenario durch. Die großen KI-Modelle werden in den USA entwickelt, die Rechenzentren dort betrieben, die Chips in Asien gefertigt. Europa nutzt die Technologien zwar – doch der Mehrwert entsteht woanders. Patente, Lizenzeinnahmen und Unternehmensgewinne fließen nach Kalifornien oder Shenzhen. Europas Rolle beschränkt sich auf die Anwendung fremder Technologien. Die Folge: ein schleichender Verlust an Wohlstand, eine digitale Abhängigkeit ähnlich wie bei Gasimporten aus Russland. Die Bürger zahlen für Abonnements und Cloud-Dienste, die Profite landen jenseits des Atlantiks.
Szenario 2: Europa setzt auf smarte Nutzung
Ein mittlerer Weg: Europa akzeptiert seine Abhängigkeit, nutzt aber die bestehenden KI-Plattformen intelligent. Unternehmen mieten Rechenleistung bei US-Hyperscalern, setzen KI ein, um Prozesse zu optimieren, Energie effizienter zu nutzen oder den Fachkräftemangel abzufedern. Chancen ergeben sich etwa in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und in der Medizin. Europa wäre dann kein Produzent von Basistechnologien, aber ein exzellenter Anwender. Der Wohlstand bliebe erhalten – allerdings unter geopolitischem Risiko, weil die Abhängigkeit von externen Infrastrukturen bleibt.
Szenario 3: Europa wird dritter globaler Player
Das ambitionierteste Szenario: Europa investiert massiv, baut eigene Rechenzentren mit günstiger und sauberer Energie, fördert gezielt KI-Unternehmen und schafft ein einheitliches, effizientes Regulierungssystem. So könnte ein dritter digitaler Machtblock entstehen – neben den USA und China. Europas Vorteil: Datenschutz, Transparenz und Nachhaltigkeit. Damit ließe sich nicht nur der heimische Markt bedienen, sondern auch global Vertrauen gewinnen – gerade bei Staaten, die skeptisch gegenüber US-Dominanz oder chinesischer Überwachung sind. Die Voraussetzung: Geschlossenheit, Geschwindigkeit und Mut zu Investitionen.
Fazit und Prognose
Welches Szenario ist realistisch? Aktuell deutet vieles auf Szenario 2 hin: Europa wird guter Anwender, aber kein Systemführer. Das liegt an fehlender Geschwindigkeit und politischen Blockaden. Doch das Zeitfenster ist nicht geschlossen. Bis 2027 könnten die geplanten AI-Factories, Chip-Werke und neue Energiepolitik den Boden für Szenario 3 bereiten. Gelingt das nicht, droht Szenario 1 – und mit ihm ein dauerhafter Wohlstandsverlust. Europa steht damit am Scheideweg: Abhängigkeit oder Aufbruch. Ob der Kontinent zum Gestalter der digitalen Zukunft wird oder nur deren Konsument, entscheidet sich in den kommenden zwei bis drei Jahren.