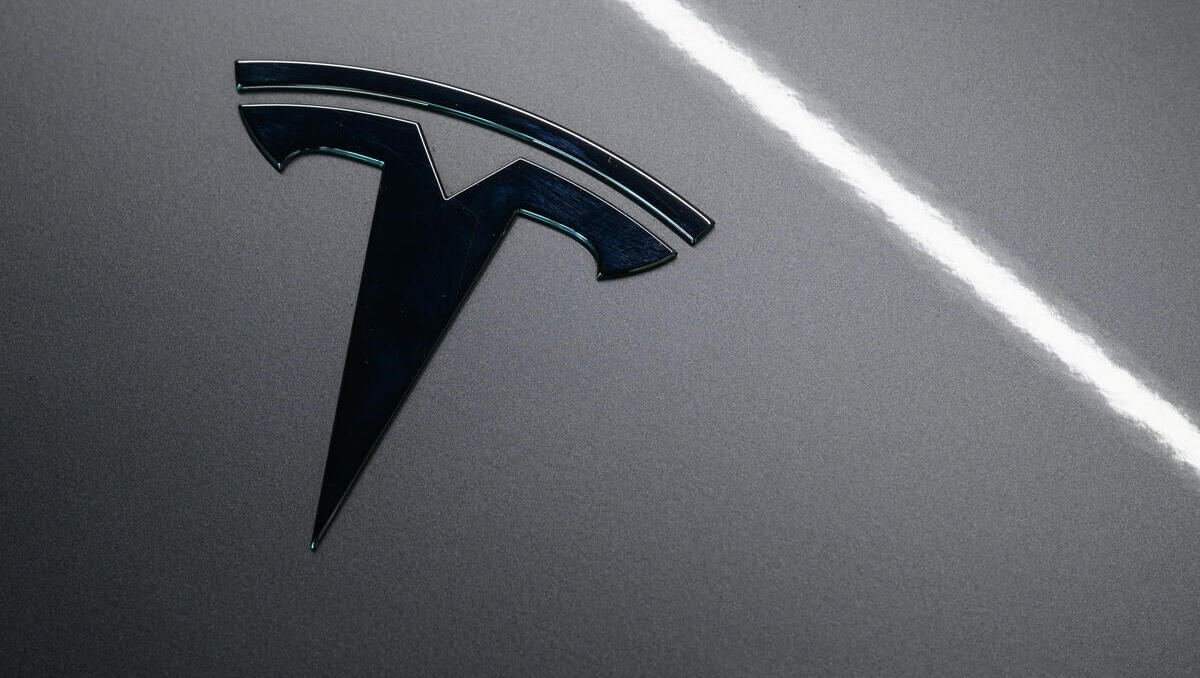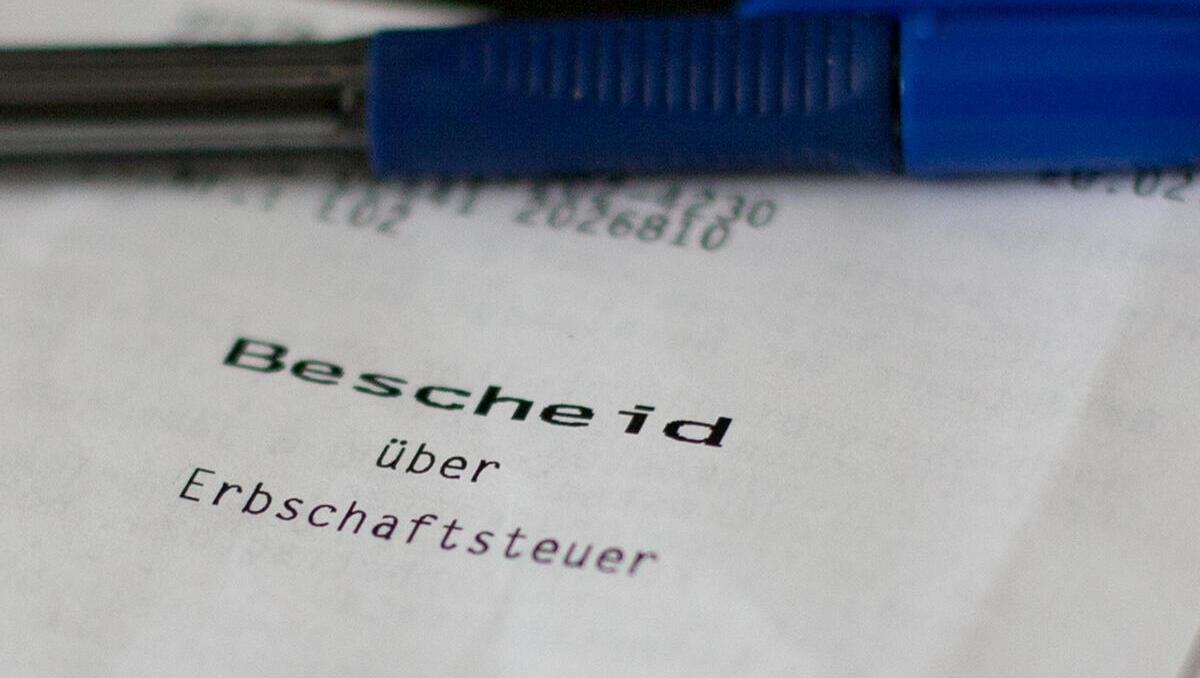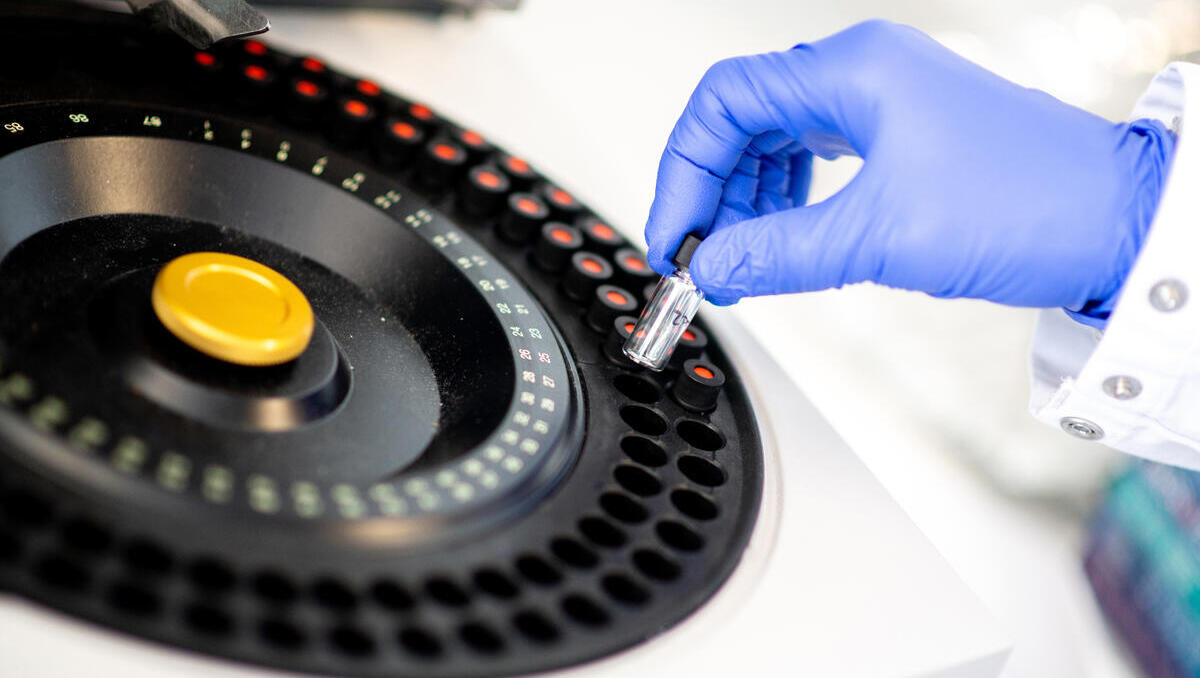Finanzen
Nach Jahren der Flaute sehen Topmanager eine Trendwende am Markt für Börsengänge. Warum Klarna den Wendepunkt markieren könnte und was...
Das Berliner Testament ist in Deutschland sehr beliebt, denn es sichert den überlebenden Ehepartner ab. Allerdings hat es auch eine Reihe...
Investoren, die die hohe Bewertung ignorierten und die Tesla-Aktie in Erwartung großer Gewinne und künftiger Marktmacht kauften, wurden...
Die Europäische Kommission hat den von der Bundesregierung geplanten Schuldenkurs bis 2031 gebilligt. Trotz geplanter Milliardenkredite...
Rekorde an der Wall Street, Warnungen vor Rezession und ein Rückschlag für Bitcoin: Anleger fragen sich, ob jetzt die Zeit für...
Viele Börseneinsteiger sind der Meinung, mit einem Margin-Konto schneller reich zu werden. Doch hinter der Verlockung des Hebels lauern...
Vertrauen allein reicht nicht: Jeder zwanzigste Käufer von Goldbarren wird getäuscht. Wir zeigen, wie Sie gefälschtes Gold erkennen und...
Im Bundeshaushalt fehlt das Geld, und immer wieder rücken dabei auch das Vermögen der Deutschen und eine gerechtere Besteuerung in den...
Die US-Börsen schwanken zwischen Euphorie und wachsender Unsicherheit. Während Analysten steigende Kurse prognostizieren, warnen Experten...
Die Amazon-Aktie hinkt 2025 deutlich hinter Nvidia, Microsoft und Co. her. Hohe Investitionen in Cloud und KI belasten den Cashflow –...
Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins für die Eurozone festgelegt – und ihn wie erwartet auf dem aktuellen Niveau von 2,0...
Seit 2022 können E-Auto-Besitzer dank der THG-Prämie bares Extra-Geld erhalten. Klingt verlockend, doch der Markt ist unübersichtlich....