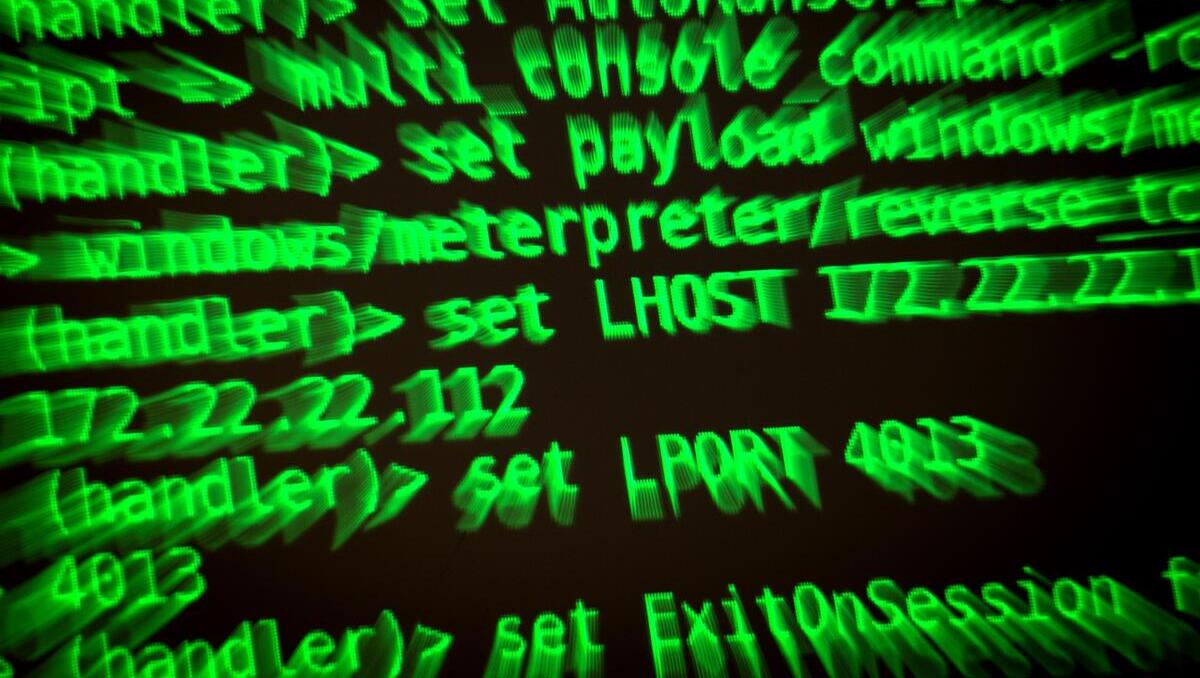Finanzen
Ein neuer Milliarden-Deal mit OpenAI lässt die Broadcom-Aktie in die Höhe schnellen – doch Insiderverkäufe und Marktunsicherheiten...
Die OPEC-Staaten drehen den Ölhahn wieder auf und der Ölpreis droht sich zu halbieren. Saudi-Arabien kämpft um Marktanteile, während...
Die Finanzmärkte stehen weltweit unter Beobachtung, da wirtschaftliche, technologische und geopolitische Entwicklungen die...
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt als einfache Kennzahl für Aktienbewertungen – doch ist sie wirklich verlässlich? Warum steigen...
Der Goldpreis erreicht ein Rekordhoch nach dem anderen. Anleger können davon profitieren, wenn Sie Gold kaufen, zum Beispiel in Form von...
Seit vier Jahren führt Mark Branson die BaFin mit eiserner Hand. Wo einst Zurückhaltung dominierte, gilt heute der „No-Mercy-Ansatz“....
Milliarden strömen in Rechenzentren und KI-Start-ups, Bewertungen für KI-Aktien explodieren ins Absurde – doch immer lauter wird die...
Vom Kreml bis Washington mischt sich die Politik zunehmend in die Märkte ein. Während Trumps Wirtschaftsnationalismus neue Gewinner...
BASF verkauft seine Lack-Sparte an Carlyle – ein Milliarden-Deal, der den Chemieriesen neu ausrichtet. Doch wie wirkt sich das auf den...
Steigende Zinsen machen Staatsanleihen riskant. Inflationsindexierte Anleihen bieten dagegen realen Schutz und könnten jetzt zu einer der...
Die Energiekontor-Aktie ist im frühen Freitagshandel eingebrochen. Der Wind- und Solarparkentwickler Energiekontor hat seinen Ausblick...
Die VW-Aktie steht im Börsenhandel am Freitag im Fokus, weil Volkswagen bei seinen VW-E-Autos in Europa kräftig zulegt. Doch während die...